Einleitung
Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938) zählt zu den wichtigsten Künstlern des deutschen Expressionismus. Schon zu Lebzeiten ist er international bekannt. Nach seinem Umzug in die Schweiz im Jahr 1917 verändert sich sein Stil deutlich. Gleichzeitig verspürt Kirchner zunehmend das Bedürfnis, seine Kunst zu erklären. Mit Briefen, unter Pseudonym verfassten Texten und persönlichen Stellungnahmen versucht er die Interpretation seiner Werke zu lenken und seine Rolle innerhalb der Moderne gezielt herauszuarbeiten.
Ein zentraler, bislang wenig beachteter Moment dieser Selbstinszenierung ist die grosse Retrospektive von 1933 in der Kunsthalle Bern – die umfangreichste Ausstellung zu seinen Lebzeiten. Kirchner kuratiert sie selbst: Er wählt die Werke aus, bestimmt ihre Hängung, entwirft und gestaltet das Plakat sowie den Katalog, gemeinsam mit Max Huggler (1903–1994), Leiter der Kunsthalle und ab 1944 Direktor des Kunstmuseum Bern.
Die Ausstellung Kirchner × Kirchner nimmt diese historische Schau zum Ausgangspunkt und rückt Kirchners eigene Perspektive auf sein Werk in den Mittelpunkt. Sie zeigt ihn erstmals als Ausstellungsmacher und Kurator seines Œuvres. Dabei wird deutlich: Die Präsentation seiner Werke ist für ihn Teil der Kunst selbst.
Das Kunstmuseum Bern lädt dazu ein, Kirchners Werk neu zu entdecken – und einem der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts auf ungewöhnliche Weise zu begegnen.
Biografische Stationen

Ernst Ludwig Kirchner wird am 6. Mai 1880 in Aschaffenburg geboren und wächst in Chemnitz auf. Nach einem Architekturstudium in Dresden gründet er 1905 mit Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff und Fritz Bleyl die Künstlergruppe Die Brücke, deren Ziel ein unmittelbarer, expressiver Stil jenseits akademischer Konventionen ist.
1911 zieht Kirchner nach Berlin, wo das Grossstadtleben seine Kunst prägt. Die Künstlergruppe Die Brücke zerbricht 1913, unter anderem aufgrund wachsender Spannungen zwischen den Mitgliedern. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs meldet sich Kirchner 1915 freiwillig zum Militärdienst, erleidet jedoch einen körperlichen und seelischen Zusammenbruch. Ab 1917 hält er sich erstmals zur Erholung in Davos auf, wo er sich 1918 dauerhaft niederlässt. Die Natur und das bäuerliche Leben werden zu zentralen Motiven seiner Kunst.
Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 1933 wird Kirchners Kunst zunehmend verfemt. Über 600 Werke werden beschlagnahmt, viele davon 1937 im Rahmen der Propagandaausstellung Entartete Kunst öffentlich diffamiert. Am 15. Juni 1938 begeht Kirchner in Frauenkirch bei Davos Suizid.
Bildnachweis:
Aura Hertwig-Brendel. Porträt von Ernst Ludwig Kirchner (Ausschnitt), 1913/14 Fotografie. Nachlass Ernst Ludwig Kirchner © Nachlass Ernst Ludwig Kirchner, courtesy Galerie Henze & Ketterer, Wichtrach/Bern
I. Der frühe Kirchner
In den Jahren seiner Zugehörigkeit zur Künstlergruppe Die Brücke (1905–1913) entwickelt Ernst Ludwig Kirchner einen expressiven Stil mit leuchtenden Farben, kraftvollen Formen und bewegten Linien. Zu seinen bevorzugten Motiven zählen Szenen des Grossstadtlebens – Menschen in Bewegung, flüchtige Blicke, kurze Begegnungen –, aber auch Zirkus, Tanzlokale und Cafés. Diese Orte erscheinen wie Bühnen der Maskerade und spiegeln eine moderne, rastlose Gesellschaft wider.
Einen Gegenpol dazu bilden intime Aktdarstellungen, die Kirchner häufig mit Freund:innen inszeniert. Auch hier bleiben die Körper in Bewegung – roh, direkt und losgelöst von gesellschaftlichen Normen. In den Landschaftsbildern dieser Jahre wiederum verdichtet sich seine Sehnsucht nach Ursprünglichkeit und einem Leben im Einklang mit der Natur. Sie wirken wie eine stille Gegenwelt zur Dynamik der Metropole.
Die Werke aus der Brücke-Zeit gelten als Höhepunkt seines Schaffens. Viele überarbeitet Kirchner jedoch nach 1920 – manche versieht er sogar nachträglich mit einem früheren Entstehungsdatum. Einige Bilder haben auf dem Weg von Berlin nach Davos Schaden genommen, andere genügen seinen späteren Ansprüchen nicht mehr. Möglicherweise sucht er auch eine bewusste Abgrenzung von seinen früheren Brücke-Kollegen und will sich als stilistischer Vorläufer der Moderne positionieren. Die überarbeiteten Werke wirken strukturierter: mit klareren Formen und homogeneren Farbflächen nähern sie sich der Ästhetik der 1920er-Jahre an. So konstruiert Kirchner im Rückblick eine stringente künstlerische Entwicklung.
II. Ein Schlüssel zum Werk
Die Retrospektive von 1933 in der Kunsthalle Bern zeigt, welchen Stellenwert Kirchner seinen Arbeiten auf Papier beimass: Im Untergeschoss präsentiert er rund 130 Zeichnungen, parallel dazu in der Galerie Gutekunst & Klipstein 49 ausgewählte Druckgrafiken. Für ihn sind diese Werke ein Schlüssel zum Verständnis seines Schaffens.
Zeichnungen und Druckgrafiken zählen bis heute zu Kirchners bedeutendsten Beiträgen zur Kunst der Moderne. In ihnen verdichtet er seine künstlerischen Ideen mit radikaler Klarheit und sucht nach neuen Ausdrucksformen für Linie, Fläche und Farbe. Diese Blätter sind für ihn eigenständige Kunstwerke, in denen sich zentrale Themen und stilistische Veränderungen besonders deutlich zeigen.
Zwischen 1907 und 1914 entwickelt Kirchner eine kraftvolle, unverwechselbare Bildsprache. Seine Motive spiegeln seine Lebensstationen in Dresden, an den Moritzburger Teichen, in Berlin und auf Fehmarn wider – vom pulsierenden Grossstadtleben bis zur Ruhe der Natur. Die stilistische Entwicklung folgt aber weniger diesen biografischen Einschnitten als vielmehr einer eigenen künstlerischen Logik.
Nach seiner Übersiedlung in die Schweiz 1917 erweitert sich sein Motivspektrum: Szenen aus dem bäuerlichen Leben, Tiere und die alpine Landschaft kommen neu hinzu. Formal knüpft Kirchner jedoch an die früheren Arbeiten an. Die Werke, die auf der Stafelalp oberhalb von Davos entstehen, wirken zugleich dynamisch und nervös – aber auch klarer und ruhiger im Aufbau.
III. Die Ausstellung von 1933
Ernst Ludwig Kirchner versteht das Ausstellen als Teil seines künstlerischen Schaffens. Er will seine Werke nicht einfach zeigen, sondern bewusst ordnen, in Beziehung zum Raum und zu den Betrachtenden setzen. Dabei geht es ihm weniger um eine chronologische Abfolge als darum, Zusammenhänge zwischen Themen, Formen und Farben sichtbar zu machen.
Die Ausstellung Kirchner × Kirchner orientiert sich an Kirchners Retrospektive von 1933 in der Kunsthalle Bern: Bildpaare werden wie damals gehängt, Motive durch Blickachsen über mehrere Räume hinweg gezielt verbunden, Farben und Kontraste bewusst inszeniert. So wird erfahrbar, wie Kirchner auch die Hängung seiner Werke als künstlerische Komposition verstand – intuitiv und lebendig.
Die in diesem Raum gezeigten Werke stammen aus seiner Schweizer Zeit (1917–1932) und waren Teil der Ausstellung von 1933 – teils dauerhaft, teils nur vorübergehend, manche nur im Hintergrund, da Werke im Verlauf der Schau verkauft und ersetzt wurden. Die Auswahl zeigt: Kirchner malte nicht nur alpine Natur und bäuerliches Leben, sondern auch das moderne Davos mit Schlittschuhläufer:innen, Tänzerinnen, Strassenszenen und moderner alpiner Architektur. In der Ausstellung von 1933 dominierten Porträts und Aktdarstellungen – ein Schwerpunkt, der auch in Kirchner × Kirchner spürbar bleibt und Kirchners Selbstverständnis als Figurenmaler unterstreicht.
Ein Höhepunkt ist die Wiedervereinigung des monumentalen Werkpaars Alpsonntag. Szene am Brunnen (1923–24 / um 1929) und Sonntag der Bergbauern (1923–24 / 1926). Beide Gemälde eröffneten 1933 die Retrospektive in der Kunsthalle Bern, wo sie im Foyer Seite an Seite hingen. Obwohl als Pendants gedacht, wurden sie seither nie mehr gemeinsam gezeigt. Alpsonntag. Szene am Brunnen wurde noch im selben Jahr vom Kunstmuseum Bern erworben – der einzige Gemäldeankauf eines Schweizer Museums zu Kirchners Lebzeiten. Sonntag der Bergbauern blieb nach Kirchners Tod zunächst jahrzehntelang in seinem Nachlass und gehört seit Mitte der 1980er-Jahre zur Bundeskunstsammlung der Bundesrepublik Deutschland. Dass das dauerhaft im Bundeskanzleramt installierte Werk für diese Ausstellung ausgeliehen werden konnte, ist eine seltene und bedeutende Ausnahme.
IV. Porträt, Akt und Tanz
Der Mensch steht im Zentrum von Ernst Ludwig Kirchners künstlerischem Schaffen. Die hier gezeigten Arbeiten auf Papier aus den Jahren 1905 bis 1933 belegen dies eindrücklich. Porträts, Aktdarstellungen und Tanzszenen gehören zu seinen wiederkehrenden Motiven. Sie spiegeln die kontinuierliche Entwicklung seines Stils ebenso wie seines Blicks auf den menschlichen Körper.
Kirchner sieht im Menschen den Ursprung aller Kunst. Für ihn ist nicht die äussere Ähnlichkeit entscheidend, sondern vielmehr der Ausdruck, das innere Erleben. Besonders in seinen Porträts sucht er nach einer tieferen Wahrheit: Die Gesichter seiner Modelle zeigen daher keine anatomische Präzision, sondern emotionale Zustände und charakterliche Eigenheiten.
Auch die Aktdarstellungen lösen sich bewusst von der akademischen Tradition. Statt idealisierter Körper zeigen sie den nackten Menschen – direkt, sinnlich, im Atelier oder in der Natur, oft in ungezwungenem Beisammensein. Kirchner verzichtet auf naturalistische Details zugunsten eines unmittelbaren Ausdrucks.
Im Tanz findet Kirchner ein zentrales Motiv zur Darstellung von Bewegung und Rhythmus. Ob Varieté, Ausdruckstanz oder rituelle Formen – der tanzende Körper wird für ihn zum Sinnbild lebendiger Energie. Mit wenigen Linien hält er flüchtige Momente fest und verdichtet sie später zu kraftvollen Zeichen dynamischer Bewegung.
V. Visionäres Spätwerk
Die Werke, die Ernst Ludwig Kirchner ab Mitte der 1920er-Jahre in Davos schafft, gelten lange als stilistisch uneinheitlich und weniger bedeutend. Der Künstler selbst jedoch sieht diese Jahre anders: 1933 bezeichnet er sie als Höhepunkt seines Schaffens.
Die Gemälde in diesem Raum entstanden zwischen 1924 und 1933. In dieser Zeit entwickelt Kirchner eine neue Bildsprache, die er selbst als Neuen Stil bezeichnet. Die spontane Ausdruckskraft der Brücke-Zeit weicht einer ruhigeren, abstrahierenden Formensprache. Sie ist gekennzeichnet durch klare Konturen, gerundete Flächen und kompositorische Geschlossenheit. Leuchtende Farben, vibrierende Linien und symbolisch verdichtete Formen verleihen vielen Bildern eine beinahe visionäre Ausstrahlung.
1933 betont Kirchner sowohl die Wandlungsfähigkeit seiner Kunst als auch die innere Kontinuität seines Schaffens. Denn auch im Spätwerk bleibt er dem Ziel verpflichtet, subjektive Wahrnehmung und existenzielle Erfahrung bildnerisch zu verdichten – nun mit Ausdrucksmitteln, die er als zeitgemäss empfindet. Im Katalog zur Ausstellung von 1933 beschreibt Kirchner diese Phase – unter dem Pseudonym Louis de Marsalle – als Moment der Sammlung und Weiterentwicklung. Bereits 1927 notiert er in seinem Tagebuch:
«Ich komme immer mehr zu Klarheit und Bestimmung meiner Arbeit. Ich begreife das ganz Neue, was sie von Uranfang an hatte […].»
Bitte benutzen Sie den Audioguide mit einem Kopfhörer. Vielen Dank!
Video-Serie: «Kirchner ist zurück»
In einer vierteiligen Video-Serie stattet Ernst Ludwig Kirchner (1880−1938) dem Kunstmuseum Bern persönlich einen Besuch ab.
Begleitprogramm
Veranstaltungen
Fragen zur Provenienz bei Kirchner
Einblicke in die Arbeit der Provenienzforschung anhand ausgewählter Werke von Ernst Ludwig Kirchner:
Graphische Blätter aus dem Legat Gurlitt
mit Anna Haesen (Provenienzforscherin)
Dienstag, 7. Oktober 2025, 18:00
Das Gemälde Dünen und Meer im Fokus
mit Katharina Otterbach (Provenienzforscherin)
Dienstag, 9. Dezember 2025, 18:00
Europäischer Tag der Restaurierung
Kirchner malt! Ein Rundgang im Zeichen der Farben, des Pinselduktus und der originalen Rahmen. Nadine Franci (Kuratorin) im Gespräch mit Nathalie Bäschlin (Restauratorin)
Sonntag, 19. Oktober 2025, 11:00
Kunst und Religion im Dialog
Beate Krethlow (Ref. Kirchgemeinde Münster) im Dialog mit Michael Krethlow (Kunstvermittler)
Sonntag, 19. Oktober 2025, 15:00
AlpSonntag
Wir holen das Alpenfeeling ins Museum und feiern den Sonntag mit Brunch, Kurzführungen, offenem Atelier und Musik. Mit einem vielseitigen Programm für alle Generationen im Rahmen der beiden Ausstellungen Kirchner x Kirchner und Panorama Schweiz.
Sonntag, 26. Oktober 2025, 10:00–17:00
Wochenende der Graphik
Am diesjährigen Wochenende der Graphik steht die Freundschaft in der Kunst im Fokus. In Sonderveranstaltungen im Kunstmuseum Bern tauchen Sie ein in die spannenden Beziehungen zwischen Künstlerpersonlichkeiten wie Kirchner, Ferdinand Hodler und Marguerite Frey-Surbek.
Sonntag, 9. November 2025, 10:30–16:00
Gespräche in der Ausstellung
Kirchners Wandel zum «Neuen Stil»
mit Dr. Alexandra Henze (Expertin Ernst Ludwig Kirchner)
Samstag, 1. November 2025, 15:00
Kleines Spiel zwischen ich und mir
mit Dr. Katharina Neuburger (Kunsthistorikerin und Kuratorin für die Kunst der Moderne und der Gegenwart)
Freitag, 12. Dezember 2025, 15:00
Führungen
Ausstellungsrundgang
Sonntag, 11:00: 14.9. / 21.9. / 28.9. / 12.10. / 2.11. / 16.11. / 23.11. / 30.11. / 7.12. / 21.12. / 28.12.2025 / 4.1. / 11.1.2026
Dienstag, 18:30: 28.10. / 11.11. / 16.12.2025 / 6.1.2026
Visite de l'exposition
mardi, 18:00 : 30 septembre 2025
dimanche, 11:30 : 14 décembre 2025
Einführungen für Lehrpersonen
Dienstag, 16. September 2025, 18:00
Mittwoch, 17. September 2025, 15:00
Workshops
s’aMUSÉE!
Atelier bilingue / zweisprachiger Workshop
samedi 18 octobre 2025 / Samstag, 18. Oktober 2025, 14:30
Kunst rundum
Interkultureller Workshop für Frauen
Samstag, 25. Oktober 2025, 14:00
Artur Kunst-Tour
Gestalterischer Workshop für Kinder (6 bis 14 Jahre)
Samstag, 8. November 2025, 10:15
Aktuell inspiriert
Im Workshop für Erwachsene (ab 16 Jahren) lassen wir uns von Kirchners Holzschnitten zu eigenen Drucken im Atelier inspirieren.
Sonntag, 9. November 2025, 14:00
Dienstag, 2. Dezember 2025, 18:00
Impressum
Kirchner x Kirchner
Kunstmuseum Bern
12.9.2025–11.1.2026
Kuratorin: Nadine Franci
Ausstellungskatalog: Kirchner x Kirchner, hrsg. von Nina Zimmer und Nadine Franci, Hirmer Verlag, München 2025. Mit Beiträgen von Nadine Franci und Katharina Neuburger sowie einem Vorwort von Nina Zimmer
Ausstellungsgestaltung: Atelier Arbre
Audioguide
Umsetzung: tonwelt GmbH
Digital Guide
Umsetzung: NETNODE AG
Projektleitung: Andriu Deflorin, Cédric Zubler
Mit der Unterstützung von:



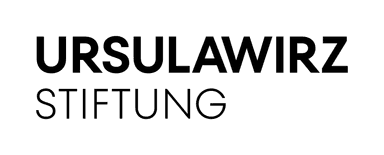




Medienpartnerin:

Kunstmuseum Bern
Hodlerstrasse 8–12, 3011 Bern
+41 31 328 09 44
info@kunstmuseumbern.ch
kunstmuseumbern.ch/kirchner

















